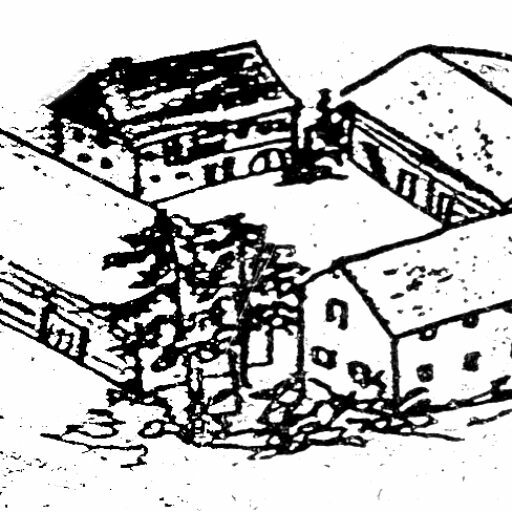Selbstorganisation
Kollektive Selbstbestimmung bedeutet für uns, dass wir über gemeinsame Belange auf Augenhöhe diskutieren und nach dem Konsensprinzip entscheiden. Jede*r Mieter*in wird automatisch Mitglied in unserem Hausverein. Dem Hausverein wiederum gehört eine GmbH, die das Haus verwaltet: Wer bei uns wohnt ist Mieter*in und Haus-Eigentümer*in zugleich.
Um Entscheidungen zu fällen, treffen wir uns regelmäßig im Plenum, das je nach Bedarf monatlich bis wöchentlich stattfinden kann. Hier tragen wir alle Belange, Neuigkeiten und Ankündigungen zusammen und schmieden gemeinsam neue Pläne. Entscheidungen werden im Konsens getroffen. Um dafür zu sorgen dass mit den Entscheidungen die wir als Hausgemeinschaft treffen auch wirklich alle Beteiligten einverstanden sind, haben wir uns entschieden, nicht einfach nach dem Mehrheitsprinzip zu verfahren. Stattdessen suchen wir stets nach Lösungen mit denen wirklich alle gut leben können. Das dauert natürlich häufig etwas länger. Dafür bekommen wir aber Entschlüsse, die wirklich von allen gemeinsam getragen werden – und keine*r fühlt sich übergangen.
Damit nicht alle in allen Bereichen (Verwaltung, Instandhaltung, Buchhaltung) eingearbeitet sein müssen, gründen wir für verschiedene Aufgabenbereiche Arbeitsgruppen (AGs). So gibt es zum Beispiel die AGs „Garten“, „Finanzen“, „Baustellen“ und viele mehr. Im Plenum wird dann die Arbeit der einzelnen Arbeitsgruppen mit den Anderen rückbesprochen und es können Fragen geklärt und die nächsten Schritte besprochen werden.
Unsere Gesellschaft ist durchzogen von hierarchischen Rastern. Während Machtgefälle nicht per se schlecht sein müssen, bringen sie leider doch eine Vielzahl an Problemen mit sich: Viel zu oft werden Machtposition zu privaten Vorteilen ausgenutzt, die Benachteiligten sind den eventuell willkürlichen Entscheidungen der Mächtigen ausgesetzt und die Struktur reproduziert so gut wie immer bereits bestehende Strukturen der Diskriminierung: Weiße, männliche, ältere, reichere, körperlich fittere Menschen die selber Kinder einflussreicher Familien waren, haben mehr Macht als andere.
Eine Welt zu bauen, die nicht auf diskriminierenden, ausbeuterischen und gewaltvollen Strukturen fußt, erfordert nicht nur Politische Veränderungen, sondern auch ein Umdenken im alltäglichen Miteinander. Wir finden, wir sollten Strukturen denken und erproben, die ohne Autoritäre Gewalt auskommen. Um selbst nicht zu herrschen, und uns nicht beherrschen zu lassen.
Wir finden dass Wohnen ein Grundrecht Aller ist, und Wohnraum daher immer grundsätzlich für alle gedacht sein muss. Wir sind genervt davon, Strukturen zu behausen die wir nicht verändern dürfen, die uns aber kein sicheres Zuhause bieten, sei es weil sie Eigentum von Imobillienfirmen, oder von privaten Spekulanten sind.
Als Teile einer solidarischen Hausgemeinschaft haben wir immer Freunde um uns, an die wir uns wenden können, wenn wir mal mit einem Problem nicht mehr alleine zurecht kommen. Wir streben generell danach so gut wir können füreinander da zu sein, und resiliente Strukturen von Gemeinschaft und Vernetzung zu bilden.
Durch die Strukter des Mietshäusersyndikats können wir außerdem niedrige Mieten für uns alle garantieren, ohne dass Menschen beim Einzug eine Summe zur Finanziellen Beteiligung vorstrecken müssen. Wie hoch die Mieten im einzelnen sind, beschließen wir dann gemeinsam in Bieterunden. Es gibt eine Gesamtmiete für das Haus und nacheinander sagt jede*r, wieviel er*sie monatlich dazu beitragen kann. Falls die Gesamtmiete nicht auf Anhieb erreicht wird, gibt es eine weitere Runde, in der alle nochmal etwas hochgehen können usw. – solange bis die Gesamtmiete gemeinsam gedeckt wird. Wie viel jede*r zahlen soll, orientiert sich nicht an den m² der jeweiligen Zimmer, sondern daran wie viel der einzelne Mensch eben zahlen kann. Finanzielle Engpässe bei Einzelnen können so von der Gruppe als ganzes durch eine solidarische Anpassung der Mieten mitgetragen werden.
Ähnlich läuft es bei unserer Essenskasse: Der Großteil des Hauses teilt sich eine Küche. Klar kann jede*r immer ihr*sein eigenes Süppchen kochen. Das ist kein Problem und wird auch so praktiziert! Letztlich haben aber alle etwas davon wenn gleich für alle gekocht wird. So hat sich bei uns auch eine gemeinsame Essenskasse ergeben, in der alle wöchentliche so viel Einzahlen wie sie können und wollen. Gemeinsame Großeinkäufe für Alle werden daraus finanziert, genauso wie unsere Gemüßekiste vom Regionalkollektiv (Das ist bei uns die nächstgelegene solidarische Landwirtschaft).
Uns ist es wichtig auch nach außen, über die Wohngemeinschaft hinaus solidarisch zu sein so gut wir können. Eine Möglichkeit das zu tun besteht darin, dass wir unseren Wohnraum bei Bedarf auch mit Menschen teilen die kurzfristig dringend eine Unterkunft benötigen, oder anderweitig dringend etwas brauchen was wir geben können.